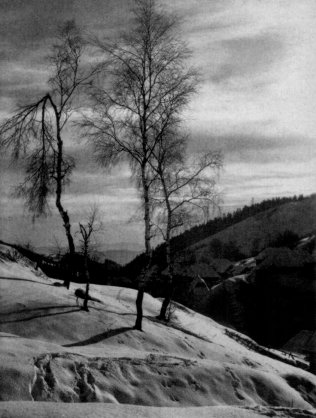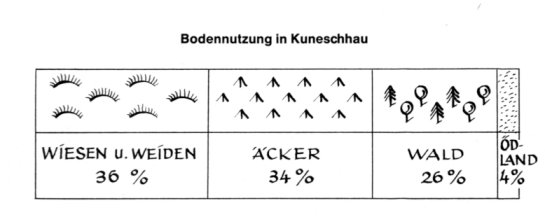|
Bild der Heimat
Lange, sehr lange müßten wir fahren, gleichviel, ob wir den Zug oder
das Auto be- nützten, um dorthin zu gelangen, wo unsere Eltern und
Urahnen einst ihr Zuhause hatten. Meilenweit im Umkreis siedelten und
siedeln dort Menschen anderer Zunge und unsere Dörfer mit ihren ehemals
deutschen Bewohnern glichen Inseln im großen slawischen Meer. Deshalb
sprach man von sogen. Sprachinseln: in unserem ehemaligen
Siedlungs- raum von der Kremnitzer Sprachinsel, d. s. die Dörfer
rings um die Stadt Kremnitz (slow. Kremnica) und die Deutsch –
Probener Sprachinsel mit den Orten, deren Mittelpunkt die Stadt
Deutsch – Proben (slow. Nemeckb Pravno, jetzt Nitrianske Pravno)
bildete. Im ganzen waren dies über 20 Ortschaften mit nahezu rein
deutscher Bevölkerung. Siehe Abschnitt: "Die anderen
Hauorte"!
Unser Heimatort Kuneschhau liegt auf derselben geographischen Breite wie
Stuttgart und denken wir uns von hier eine Linie genau nach Osten
gezogen, so kämen wir nach einer Luftlinie von 700 km ungefähr in die
Gefilde unserer ehemaligen Heimat.
Der Ort erstreckt sich in einer Länge von etwa 3 km von N nach S, genau
in der Mitte der langen Häuserreihe stehen Kirche und Schule. Der
nördliche Teil, der "Oberort", liegt ziemlich offen
auf einer Hochebene mit 800 m Seehöhe, die Südhälfte, der "Unterort",
ist dagegen in ein enges Tal eingezwängt. Der Höhenunterschied
zwischen Ober- und Unterort dürfte 90 – 100 m betragen.
Das Gesamtareal der Gemarkung verfügt über ein Ausmaß von 3810 ha.
Bei der Volkszählung i. J. 1910 weist die Statistik einen
Einwohnerstand von 1913 Seelen aus, von denen 1876 als zur
deutschen Volksgruppe zugehörig gerechnet und nur 37 als "Anderssprachige"
angegeben wurden. Die Volkszählung i. J. 1930 wurde nicht nach der
Muttersprache, sondern nach der Umgangssprache durchgeführt; der
deutsche Bevölkerungsanteil erhöhte sich auf 1967, der slowakische
Anteil blieb unverändert. Die in Krickerhau (Handlova) lebenden
Familien sind mit eingerechnet.
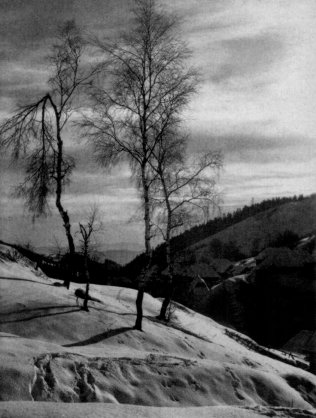
Schneelandschaft im Unterort
Alle Bewohner bekannten sich damals ausschließlich zur röm.-kath.
Kirche. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges war der Name Kuneschhau
ungebräuchlich. Nur im Volksmunde gebrauchte man Formen, die der
heutigen ähnlich waren: Koneschhay, Kunuschhaw, Kuneschhäu, Kuneschhay.
Namhafte Sprachforscher haben indes erwiesen, daß allein die Namensform
Kuneschhau die richtige und deshalb allen anderen Dialektformen
vorzuziehen sei.
Die Slowakei und mit ihr unsere Heimat, gehörte bis dorthin zum
ehemaligen Königreich Ungarn, die Staats- und Amtssprache war
madjarisch und somit wurde auch der Name unseres Heimatortes nur
ungarisch geführt: Kunosvagasa, spr. Kunoschwagascha. In der Schule
wurde vornehmlich in der Staatssprache unterrichtet, nur in der Kirche
wurde beim Gottesdienst, bei Predigt und Gesang sowie beim Beichthören
die Muttersprache berücksichtigt. Auf Grund der Friedensschlüsse nach
dem Ersten Weltkrieg wurde bekanntlich die Slowakei (das ehemalige
Oberungarn) vom Königreich Ungarn abgetrennt und bildete von nun an
einen Teil eines neuen Staatsgebildes, der Tschechoslowakei. Die
Amtssprache war jetzt slowakisch und so änderte sich auch unser
Ortsname auf Kunesov, spr. Kuneschoff.

Unterort und Mittelort von Heckels Rand aus aufgenommen
Das Landschaftsblld rings um Kuneschhau hat
Mittelgebirgscharakter: Ein Kranz von sanften Höhenzügen umsäumen den
Ort, von überall erblickt man in der Weite einzelne Häusergruppen,
seien es die vom Ober- oder Unterort. Die letzten Wohnsiedlungen im
Oberort liegen bereits auf der Wasserscheide zwischen Gran
einerseits und der Turz, bzw. Waag anderseits, beide
Nebenflüsse der Donau am linken Ufer. Seltsame Bergnamen begegnen uns
hier: Scheibe, Steinhübel, Huttenhübel, Spennelspitz, Schindelhengst,
Melterstein, Volle Henne, Trenntrichhübel, Überschann, Ziegenrücken,
Mühlborn, Bärenwinkel, Stadelbusch, Goldbrünnel, Hirtengründel,
Steffelsrand, Mühlwiese, Totenwald, u. a., alle zwischen 900 und 1100
m.
Die Landwirtschaft
Im allgemeinen mußte mit zwei Behinderungsfaktoren gerechnet werden:
die weniger tiefgründige Ackerkrume und das durch die Höhenlage rauhe
Klima. Nicht umsonst sagte man oft: "Neun Monate Winter und drei
Monate kalt." Dementsprechend beschränkte man sich beim Anbau mehr
auf weniger anspruchsvolle Getreidesorten, vor allem Hafer und Gerste,
aber auch Sommerroggen. Baute man aber Winterroggen und Weizen an,
mußte man mitunter eine Auswinterung der langen Winter wegen in Kauf
nehmen.
Lange Zeit hatte man sich an die mittelalterlichen agrarrechtlichen
Formen der Dreifelderwirtschaft gehalten. Man hatte demgemäß
die für den Anbau bereitgehaltene Ackerflur in drei Teilstücke
aufgeteilt: auf dem ersten stand Wintergetreide (Winterroggen,
Winterweizen), auf dem zweiten Sommer- getreide, während das
dritte Teilstück brach lag. Im Jahr darauf folgte auf der
vorjährigen Wintergetreidefläche, auch "Winterung" genannt,
Sommergetreide ("Sommerung") und auf der Sommergetreidefläche
die Brache. Sie wurde im Spätsommer umgebrochen und mit Wintergetreide
bebaut.
Diese Gesetzmäßigkeit wurde indes schon im 19. Jh. durchbrochen, indem
man anstatt Brache Hackfrüchte (Kartoffeln, Rüben) oder Rotklee
anbaute. Flachs, Erbsen, Bohnen oder Mohn baute man auch als
Sommerfrucht. Die Dreifelderwirtschaft läßt sich in Kuneschhau
insofern nachweisen, daß die bis zur Gemeindegrenze verlaufenden
Flurstreifen in Vorderfeld, Mitterfeld und Hinterfeld
einteilte, die dann nach der genannten Gesetzmäßigkeit bewirtschaftet
wurden.
Bei der alten Dreifelderwirtschaft herrschte Flurzwang, demnach
konnte keiner aus der Reihe tanzen. Als vor 110 Jahren der Bauer Anton
Grollmuß (vom Salleis) sich dafür einsetzte, den Flurzwang zu beenden,
wäre er beinahe von der Obrigkeit mit dem Tode bestraft worden.
Trotzdem lockerte man den Flurzwang, und jeder Besitzer konnte auf
seinem Grund wirtschaften, wie er wollte.
Zum Vorderfeld, Mitterfeld und Hinterfeld hatte jedes Anwesen noch die "Haua".
Dieser Flurname geht auf das Wort "hauen" zurück. So gab
es des "Krebesn Haua", des "Kretschn Haua" oder des
"Jëigls Haua". Dieser Flur- teil war erst gerodet worden, als
der Flurstreifen vom Dorf zur Gemeinde- grenze infolge Erbteilung nicht
mehr ausreichte. Für jedes Anwesen oder für eine Anwesengruppe,
meistens drei oder sechs Anwesen, lagen die Flächen im "Haua"
beisammen. Es konnte dort auch nicht den sonst herrschenden Flurzwang
geben.
Bei der Rodung wurden die Flächen entsteint; die dabei gesammelten
Steine wurden an den Grenzen der jeweiligen Haua aufgeschlichtet.
Die Bewirtschaftung der einzelnen Flächen war in Kuneschhau durch die
weiten Wege sehr erschwert. In den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg
dachte man daran, eine Aussiedlung von Betrieben in die Flur
vorzunehmen. Das wäre mit einer Flurbereinigung verbunden gewesen. Doch
dazu war es nicht mehr gekommen.
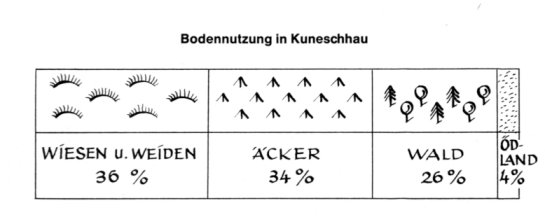
Nur wenige Landwirte konnten allein aus ihrem Betrieb ihren
Lebensunterhalt bestreiten. Einige bekannte seien hier noch genannt:
Rückschloß Ignaz, (paum Pëintadiesl)
Gürtler Franz, (paum Kretschn)
Schwarz Franz, (paum oberen Prokein)
Ernek Josef, (Oberort)
Bei der letzten Viehzählung wurden etwa
|
|
20
|
Pferde
|
|
|
498
|
Kühe
|
|
|
291
|
Ochsen
|
|
|
445
|
Stück Jungvieh
|
|
|
20
|
Schafe und
|
|
|
10
|
Bullen
|
|
registriert.
In den kleineren Betrieben ersetzte die Hand die Maschine fast
vollkommen, nur die mittleren oder größeren Landwirtschaften hatten
Ochsen- oder Pferdegespanne. Traktoren, Mähdrescher oder andere Großmaschinen standen bis in jüngster Zeit nicht in Verwendung. Ihr
Einsatz wäre bei der vorhandenen Flurform (mehr oder weniger schmale,
langgestreckte Hufen) auch nur beschränkt möglich gewesen; in letzter
Zeit aber wurden Göpel und Benzinmotoren als Antriebsmaschinen schon
gebraucht.
Beschaffung des Bodens in der Gemarkung Kuneschhau
| 1. |
Leichte, sandige Braunerde |
50%, |
Ackerkrume |
25 cm |
| 2. |
Lehmiger Sand, leichte Schwarzerde |
13%, |
Ackerkrume |
25 cm |
| 3. |
Steiniger Lehmboden |
25%, |
Ackerkrume |
20 cm |
| 4. |
Stark mit Steinen durchsetzter Boden |
|
|
|
|
mit wenig Ackerkrume |
12%, |
Ackerkrume |
15 cm |
Verwendung der Ackerflächen zum Anbau
| Hafer, Gerste, Roggen, Weizen |
71 % |
| Kartoffeln |
18 % |
| Hülsenfrüchte und Leinsamen |
7 % |
| Futterrüben, Feldgemüse (Kohl) |
3 % |
| Mohn |
1 % |
Neben den privatwirtschaftlichen Äckern
gab es auch gemeindeeigene Felder, die für die Bullenhaltung die
notwendigen "Körner" und die Streu lieferten und die
gemeinschaftlich bearbeitet wurden.
Durch die Höhenlage bedingt, gab es fast nur einschnittige Wiesen. Auch
begann ja der allgemeine Weidebetrieb schon nach der Heuernte
(eigentlich war der Pfingstmontag der Lostag für den Beginn des
Weidebetriebes). Da die Weideflächen oft nicht ausreichten, trieb der
Gemeindehirt das Vieh auch auf vorhandenen brachliegenden Felder. War
die Ernte vorüber, wurde das Vieh überall hingetrieben. Von einem
Weideplatz zum anderen wurden Viehwege angelegt (Voibëig). Nach
Michaeli (29. Sept.) war der Hirte Herr über die ganze Flur und er
durfte das Vieh überall hintreiben ("Michjoil – ku ma hüttn,
bëu ma boill" oder "Michaeli ist vorüber, geht die Hut über
und über").

Kuneschauer Dorfidyll, Pfarrhaus und Kirche
Der Wald
Der Wald war mit geringen Ausnahmen Allgemeingut. Der Besitzer war
die Urbarialgemeinde. (Siehe Abschnitt über die Urbarialgemeinde.)
Handel und Gewerbe
Die meisten Konsumgüter holte man sich gewöhnlich aus der Stadt
Kremnitz, später allerdings, als sich der Lebensstandard zu heben
begann und der Bedarf allmählich wuchs, war man froh, daß sich
Unternehmer fanden, die sich "Gemischtwarenhandlungen"
einrichteten und somit die notwendigsten Güter für den alltäglichen
Gebrauch im Dorfe selbst besorgt werden konnten. Handel und Gewerbe.
Die meisten Konsumgüter holte man sich gewöhnlich aus der Stadt
Kremnitz, später allerdings, als sich der Lebensstandard zu heben
begann und der Bedarf allmählich wuchs, war man froh, daß sich
Unternehmer fanden, die sich "Gemischtwarenhandlungen"
einrichteten und somit die notwendigsten Güter für den alltäglichen
Gebrauch im Dorfe selbst besorgt werden konnten.

Bild a. d. Gegenwart: Mittelort mit Schule,
Rechts im Hintergr. Ruine des Erbrichterhaus
Zuletzt waren Einrichtungen in dieser Hinsicht in Kuneschhau vertreten:
Selbstständige Handwerker
| Schreinerwerkstätte |
Inh. |
Johann Prokein |
243 |
| Schreinerwerkstätte |
Inh. |
Johann Prokein |
201 |
| Wagnerei und Drechslerei |
Inh. |
Franz Wagner |
333 |
| Schuhmacherwerkstätte |
Inh. |
Alois Drienko |
216 |
| Schuhmacherwerkstätte |
Inh. |
Ignaz Patsch |
204 |
| Schuhmacherwerkstätte |
Inh. |
Josef Oswald |
61 |
| Schneiderwerkstätte |
Inh. |
Josef Puskayler |
44 |
| Schneriderwerkstätte |
Inh. |
Josef Fronz |
24 |
| Zimmermeister |
Inh. |
Paul Straka |
163 |
| Leinsamenpresse |
Inh. |
Anna Ihring |
237 |
Betriebe
| Sägewerk Urbarialgemeinschaft |
|
|
|
| Mühle |
Inh. |
Ignatz Neuschl |
9 |
| (genannter hat die Mühle von dem früheren Besitzer
Jan Petrovic im Jahr 1938 käuflich erworben.) |
|
|
|
| Unteres Sägewerk beim Lëinketsch |
Inh. |
Anton Ihring |
285 |
Geschäftsleute
| Konsumgenossenschaft (Lebensmittel) |
Vorst. |
Andreas Prokein |
212 |
| Gaststätte und Lebensmittel |
Inh. |
Anton Latzko |
312 |
| Gaststätte und Lebensmittel |
Inh. |
Johann Wollner |
36 |
| Gaststätte mit Postablage |
Inh. |
Anton Gürtler |
217 |
| Gaststätte |
Inh. |
Johann Ihring |
124 |
| Tabaktrafik |
Inh. |
Johann Siemer |
198 |
| Textilwarenhandlung |
Inh. |
Johann Ihring |
200 |
| Eisenwarenhandlung |
Inh. |
Johann Fronz |
208 |
| Fleischwarenhandlung |
Inh. |
Johann Neuschl |
204 |
| Fleischwarenhandlung |
Inh. |
Josef Neuschl |
4 |
An den Seitenwänden unserer schönen Kirche sah man
einst (sieht man noch) das Bergwerksemblem: Schlägel und Eisen! Hier,
wo sich sonn- und feiertags der größte Teil der Gemeinde versammelt
sah, wollte man bekunden, daß Kuneschhau seit seiner Entstehung im
großen und ganzen das geblieben war, was es immer war: ein Bergarbeiterdorf.
|