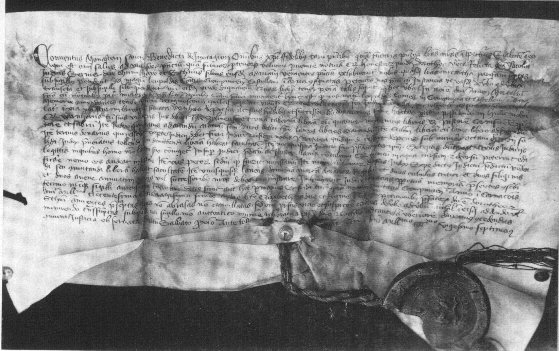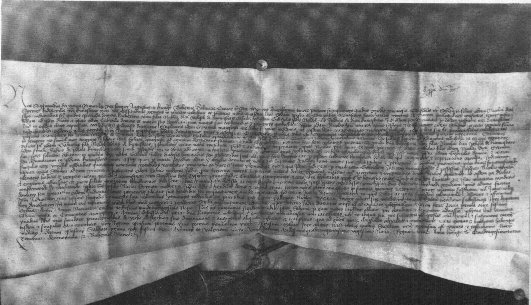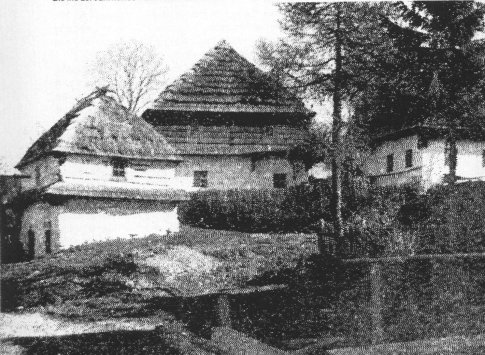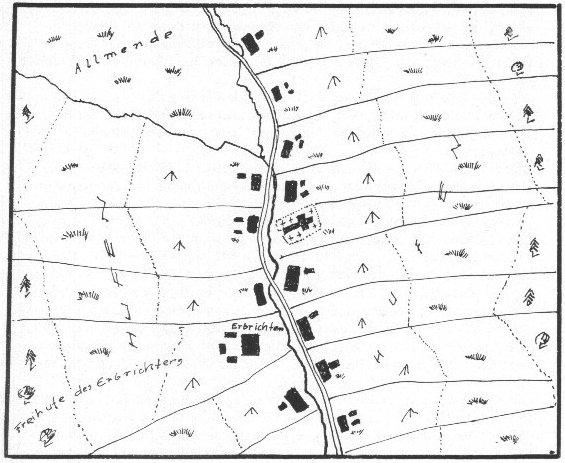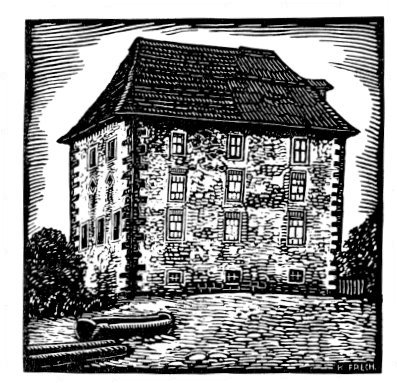|
Aus der Entstehungsgeschichte
unseres
Heimatortes Kuneschhau
Wenn man bei Kuneschhau auf einer der vielen
Anhöhen steht und die Blicke in das Tal hinabschweifen läßt, kann man
die ganze Dorfanlage überblicken: eine sich schier endlos dahin
ziehende lockere Häuserreihe, charakteristisch nicht nur für
Kuneschhau allein, sondern für alle übrigen Hauorte der beiden
Sprachinseln.
Aus den Häusern ragte einst (jetzt ist der stolze Bau eine Ruine!) ein
wuchtiger, stockhoher Steinbau heraus, der die Aufmerksamkeit jedes
Beschauers auf sich locken mußte. Es war dies das ehemalige, sogenannte
Erbrichterhaus und diente seinerzeit dem Erbrichter, Dorfschulzen oder
Bürgermeister im heutigen Sinne, als Wohnung.

Ehemalige Erbrichterei (Kretschn) im heutigen Zustand
Das ging aus den Urkunden
hervor, die jeweils vom Hausältesten aufbewahrt wurden. Es gebührt den
Bewohnern höchste Achtung, daß sie diese Dokumente wie ein Heiligtum
behütet haben, damit diese bis in die Gegenwart herübergerettet werden
konnten.
Der Text war in mittelalterlicher Urkundenlatein abgefaßt und gewährte
Einblick in die Entstehung und Entwicklung unseres Heimatortes, der
durch den Umstand eine Vorzugsstellung unter allen Orten der beiden
Sprachinseln einnimmt.
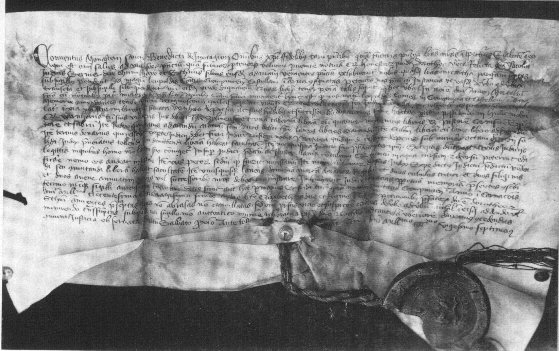
Urkunde über die Gründung von Kuneschhau im Jahr 1342
Eine der Urkunden besagt, daß anläßlich der Verleihung der
Erbgerichsbarkeit durch Magister Leopoldus, Kammergrafen in Kremnitz, an
Vernherus de Potska (der erste Richter in Kuneschhau!) i.J. 1342 der Ort
Kuneschhau unter dem Namen "villa sancti Michaelis" genannt
wurde. Die Urkunde selbst, so steht im Kremnitzer Stadtarchiv vermerkt,
wurde von dem Notar Syfried verfaßt und ausgestellt.
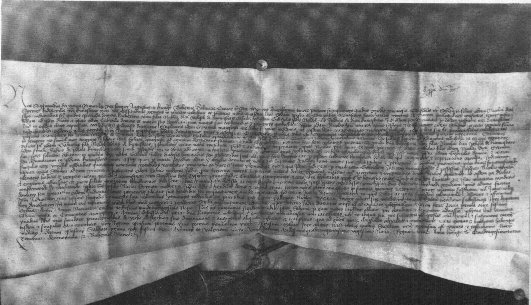
Urkunde über den Verkauf des Ortes Kuneschau im Jahr
1429 an die Stadt Kremnitz
Eine andere Urkunde berichtet, daß dem "ludex", dem Richter,
das Recht zugesprochen wird, bei Gericht vorzusitzen, die ihm
gebührenden Abgaben abzuverlangen und seinen steuerfreien Besitz von
den "Untertanen" bestellen zu lassen. Er hatte auch die
Erlaubnis zu einer Mühle, einer Fleischerei, einer Schmiede- oder
Schusterwerkstätte und vor allem zur Schanktätigkeit. Das Haus der
ehemaligen Erbrichterei in Kuneschhau wurde mit dem Namen "beim
Kretschn" genannt.
Das Richteramt war erblich, konnte aber an andere Personen verkauft
werden. In einer Urkunde aus dem Jahre 1429 heißt es, daß "die
Gerichtsbarkeit" im besagten Kunushaw mit allen Einkünften (das
erste Mal wurde dieser Name gebraucht!), wie immer sie genannt sein
mögen und dem erwähnten Richter Gabriel zu eigen waren, nun dem neuen
Richter Stephanus für 300 Mark und drei kleine Mark, die Mark zu 133
Denaren gerechnet, verkauft werde".
Schwere Verbrechen, wie Mord, Diebstahl oder Brandlegung, mußten vor
dem königlichen Gericht verhandelt werden. Die noch bis zuletzt
allgemein gebräuchliche Bezeichnung "Richter" für den
Bürgermeister rührt noch von dieser Tätigkeit her, obwohl jene
Funktion nach Einführung der amtlichen Gerichte längst auf diese
übergegangen war.
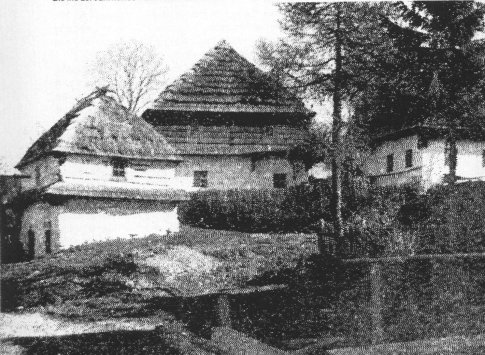
Bauweise in Alt-Kuneschhau. Bis ins 20. Jahrhundert hielt
man daran fest.
Im gleichen Jahr kam es zwischen der königlichen Kammer, die die
Belange des Königs wahrzunehmen hatte (Vgl. die Ärztekammer oder
Advokatenkammer!) und der Stadt Kremnitz aus verschiedenen Gründen zu
einem offenen Konflikt. Der ungarische König Sigismund (zugleich
deutscher Kaiser) brauchte zu dieser Zeit viel Geld. So wurde u.a. auch
Kuneschhau, das ja bis dorthin königlicher Besitz war, an die Stadt
Kremnitz verkauft. Nun geriet unser Heimatort unter städtischer
Herrschaft. Dieser Zustand währte bis zur Aufhebung der
Erbuntertänigkeit im Jahr 1848 bzw. bis zur Kommassation im Jahr
1883-1887, wobei die Besitzverhältisse bes. die Ablösung der Wald- und
Weidenutzungsrechte, neu geregelt wurden.
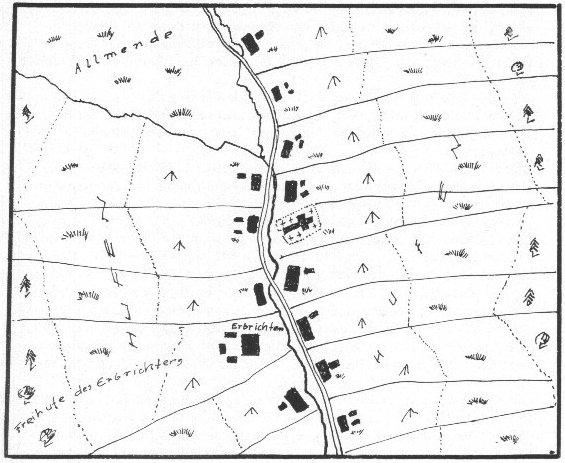
Siedlungsform eines Waldhufendorfes
/|\ Acker - ,;;,, Wiese - {} Wald
Die Erscheinung nun, daß die Namensform im Grundwort die Silbe "--
hau" aufweist, läßt auf die mittelalterliche Rodung schließen.
"Hauen" ist ein aus dem Forstwesen stammender Ausdruck und
bedeutet das selbe wie "reuten" oder "roden". Diese
Benennung deutet also unzweifelhaft auf die Entstehung der Siedlung auf
urbar gemachtem Lande hin und wir können daraus auch gewisse Schlüsse
auf die Herkunft der ersten Siedler ziehen: denn Ortsnamen mit dieser
Endsilbe treten häufiger nur im ostmitteldeutschen Gebirgsraum auf, wie
z.B. Schreiberhau im Riesengebirge oder Keilhau in Thüringen.
Meist gab ein vom Bach durchflossenes Waldtal die Ansatzbasis zu einer
Neugründung.
Längs des Baches und Weges reihen sich Haus an Haus, hinter denen sich
in langen Streifen der bäuerlichen Grundbesitz anschließt, der in der
Regel auf der Höhe in einem Waldstück abschließt. Zwischen den Höfen
liegen mehr oder minder breite Lücken. Die auf solche Art angelegten
Dörfer bezeichnet man als "Reihen-" oder besser als "Waldhufendörfer".
Zur Zeit der Entstehung unseres Heimatortes gehörte das Land dem
König, einem weltlichen oder geistlichen Grundherrn. Kuneschhau wurde
auf ehemaligem königlichem Besitz angelegt. Als nämlich König Karl
Robert von Ungarn im Jahr 1328 an Kremnitz das Stadtrecht verliehen
hatte, verfügte er, daß die Stadt zwei Meilen Land im Umkreis zu
"ihrer eigenen Kultivierung" haben solle. In diesen Bannkreis
fiel unter anderem auch Kuneschhau.
Der König beauftragte nun seinen Vertreter, den sogenannten Lokator,
ein angemessenes Waldstück roden und besiedeln zu lassen. Dabei wurde
gleichzeitig die Anlage des Dorfes festgelegt: "der Ort könne sich
bachauf- und -abwärts ausbreiten". Den Neusiedlern wurde eine
Hofstätte nebst einem Stück Rodungsland zugesprochen, das groß genug
war, eine Bauernfamilie zu ernähren. Dieser Besitzstreifen wurde
"Hufe" genannt und war ungefähr so breit wie die Hausanlage,
erreichte aber oft eine beträchtliche Länge, denn darauf verteilte
sich der gesamte Grundbesitz: Äcker, Wiesen, Weiden und der Wald.
Die Hufen wurden in erster Zeit auf den ältesten oder jüngsten Sohn
nach dem Ahnerbrecht vererbt. Durch fremden Einfluß wurde jedoch
mehr und mehr die Erbteilung geübt, die durch immerwährende
Unterteilung an sämtliche Erben eine Verarmung des Bauernstandes
herbeiführte.
Der Bauer war nun nicht, wie es scheinen mochte, wirklicher Besitzer
seines Grundstückes, wenn auch dieses vererbt werden konnte, sondern
bloß Nutznießer. Dafür hatte er verschiedene Abgaben zu leisten, die
teils in Naturalien, teils mit Geld zu bestimmten Zeiten (zu Georgi oder
Michaeli) entrichtet werden mußten. So mußten Dörfer in Kuneschhau je
Hufe eine Mark "Königsdenare", zwei Scheffel Roggen,
Hülsenfrüchte und Hafer abliefern. Neuen Ansiedlern wurden zur
Erleichterung einige, in der Regel sechzehn Freijahre gewährt.
Kuneschhau (und die deutschen Dörfer der Sprachinsel) wurden bei ihrer
Gründung mit dem deutschen Recht ihrer Heimat begabt. Nach den
vorhandenen Urkunden bedienten sich die Dörfer des Hauerlandes vorerst
des Silleiner Rechtes (Sillein = Zilina), das auf das Breslauer, bzw.
Magdeburger Stadtrecht zurückging.
Zeitlich gesehen, begann die Besiedelung des Gebietes unserer Heimat im
Zuge der deutschen Ostkolonistation am Anfang des 14.Jahrhunderst
und dauerte wohl bis ins 15. Jahrhundert hinein.
Die Frage nach der Herkunft unserer Ahnen und was sie vor Jahrhunderten
bewogen haben mochte, ihre angestammte Heimat zu verlassen, ist trotz
vieler Forschungsergebnisse nicht erschöpfend beantwortet worden. Es
wird angenommen, daß eine rein agrarische Besiedlung kaum stattgefunden
hat, sondern nur im Anschluß an das Bergwerksunternehmen in Kremnitz.
Die Neusiedler dürften also "zu Hause" unter ähnlichen
Verhältnissen gelebt haben, und die Lokatoren haben sich bestimmt
Fachleute ausgesucht, die mit der Arbeit und Lebensweise eines Bergmanns
vertraut gewesen waren. Keine Urkunde berichtet über die Herkunft
unserer Ahnen. Nur nach Mundart, so haben Sprachwissenschaftler
festgestellt, könnten Hinweise über das Herkunftsland, bzw. die
Herkunftsländer abgeleitet werden, denn, so wird behauptet, wieviele
Familien, so viele Herkunftsorte!
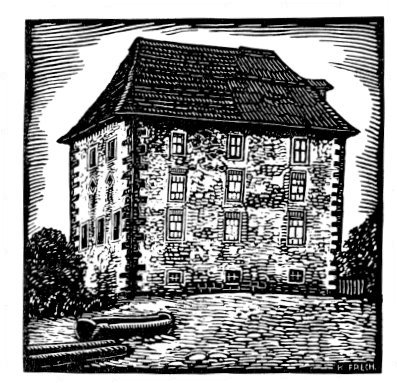
Erbrichterhaus in Kuneschhau
Die Häufigkeit einzelner Familiennamen, wie Daubner, Ihring , Neuschl,
Oswald, Prokein, Rückschloß, um nur einige zu nennen, bezeugen, daß
am Beginn der Gründungszeit nur wenige Siedler in der Gefolgschaft der
Rodungsleute zu finden waren; sie gingen wohl kaum über ein Dutzend
hinaus.
Für Kuneschhau selbst treffen wohl jene Forschungsergebnisse zu, die
besagen, daß die Mundart im allgemeinen ostmitteldeutsche, vor
allem also schlesische Merkmale aufweisen, jedoch von bayrischen
Sprachelementen durchdrungen war. Festgehalten muß auch werden, daß
nach den "hussitischen Wirren" in der ersten Hälfte des 15.
Jahrhunderts viele deutsche Bergleute, die damals berühmte Bergstadt
Kuttenberg in Innerböhmen verlassen mußten und, nachdem sich diese
gegen Osten wandten, im Kremnitzer Goldbergwerk Aufnahme fanden (M.
Matunák). Doch aus welcher Himmelsrichtung immer unsere Vorfahren
dieses rauhe, waldige Niemandsland einst betraten, Siegessäulen
brauchte man ihnen nicht zu errichten, denn sie kamen nicht mit Schwert
und Kriegstrommel, sondern folgten dem Rufe der Herrscher dieses Landes,
um den Urwald zu roden, das Erz zu schürfen, kurz um friedliche Arbeit
zu leisten, um genau sechs Jahrhunderte lang allen Widerwärtigkeiten zu
trotzen und mit zähem Willen in echter deutscher Treue am überkommenen
Glauben und Volkstum festzuhalten - bis zum bitteren Ende.
|